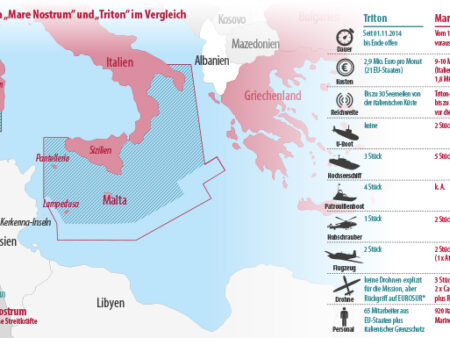Im Mai wurde die Anti-Rassismus-Politik Deutschlands durch die internationale Gemeinschaft umfassend beleuchtet. Die Bundesregierung hatte dem Anti-Rassismus-Ausschuss der Vereinten Nationen in Genf ihren turnusgemäßen Staatenbericht zur Umsetzung des internationalen Übereinkommens gegen rassistische Diskriminierung vorgelegt. Obwohl der Ausschuss diesbezüglich auf akute gesellschaftliche Problemlagen hingewiesen hat, fristet das Übereinkommen auch fast ein halbes Jahrhundert nach dessen Unterzeichnung in Deutschland ein Schattendasein. Was hat das Schweigen über die Anti-Rassismus-Konvention hierzulande mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Schweigen über Rassismus zu tun? Ein Kommentar.
Der Anti-Rassismus-Ausschuss
der Vereinten Nationen (UN; siehe Infobox) tauchte erstmals im Frühjahr 2013 prominent in den deutschen Medien auf. Der Türkische Bund hatte beim Ausschuss Beschwerde eingereicht, nachdem sich Thilo Sarrazin in einem Interview in der Kulturzeitung „Lettre International” verächtlich über Menschen mit türkischem und arabischem Migrationshintergrund geäußert hatte. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen den ehemaligen SPD-Finanzsenator zuvor eingestellt, da sie seine Worte als freie Meinungsäußerung wertete. Der UN-Ausschuss sah dies anders. Er ließ keinen Zweifel daran, dass die Aussagen Sarrazins rassistisch waren. Die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung habe Grenzen, hieß es. Zu diesen Grenzen gehöre insbesondere die Verbreitung rassistischen Gedankenguts (vgl. Ausgaben 6/13, 5/13, 1/11).
Dass Staat und Behörden sich in Deutschland schwer damit tun, Tatbestände als rassistisch einzuordnen, ist spätestens seit der Aufdeckung der rechtsextremistisch motivierten Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU) einer breiten Öffentlichkeit bekannt (vgl. Ausgaben 1/14, 7/13). Auch darüber hinaus sind viele Betroffene von rassistischer Gewalt und Anfeindungen mit dem Nichteinschreiten deutscher Institutionen tagtäglich konfrontiert. So mahnt der UN-Ausschuss in seinem aktuellen Bericht die Verankerung eines effektiven Rechtsschutzes gegen rassistische Hassreden wiederholt deutlich an.
Wie kommt es zu der unterschiedlichen Auslegung aktueller Phänomene in Bezug auf Rassismus? Eine Antwort liegt im diffusen und verkürzten Rassismusverständnis, das in Deutschland vorherrscht. Dass der Begriff hierzulande vielfach gemieden wird, liegt unter anderem daran, dass mit Rassismus vor allem die Verbrechen des Nationalsozialismus assoziiert werden. Auf gegenwärtige Zustände angewendet erscheint der Begriff daher häufig als unpassend und emotional zu aufgeladen. Stattdessen werden Ausdrücke wie Xenophobie, Fremden- oder Ausländerfeindlichkeit verwendet.
Diese Bezeichnungen sind jedoch aus mehreren Gründen problematisch: „Ausländerfeindlichkeit“ blendet aus, dass sich die „Feindlichkeit“ nicht nur gegen „Ausländer“ richtet, sondern auch gegen bestimmte „Inländer“ beziehungsweise deutsche Staatsbürger, denen aufgrund ihres Aussehens ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird. Mit dem Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ wird den Betroffenen unterstellt, sie seien „Fremde“. Sie werden mit dieser Bezeichnung als „Andere“ einem gesellschaftlichen „Wir“ gegenübergestellt. Ihre vermeintliche Andersheit erscheint dann als quasi natürliche Ursache beziehungsweise Voraussetzung von Feindlichkeit, die darüber zugleich als ein primär individuelles Einstellungsproblem verharmlost wird. Strukturelle, gesellschaftliche und historische Zusammenhänge als Nährboden von Rassismus bleiben bei diesen Begriffsdefinitionen außen vor.

Sicher tut Deutschland gut daran
– auch aufgrund seiner besonderen Historie des Rassismus, die sich nicht nur aus dem Nationalsozialismus, sondern auch aus dem Kolonialismus speist – einen sensiblen Umgang mit dem Begriff der „Rassendiskriminierung“, wie es bei den Vereinten Nationen in der deutschen Übersetzung heißt, zu suchen. Schließlich suggeriert der Begriff eine Diskriminierung aufgrund von „Rasse“, die es aber bekanntlich nicht gibt. „Rassismus schafft Rasse und nicht umgekehrt“, heißt es im Staatenbericht. Diese Überzeugung ist eine genauso wichtige Erkenntnis wie die darin verankerte Betonung der Bundesregierung, dass sie „Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, ausdrücklich zurückweist“.
Allerdings reicht eine Kritik am Begriff der „Rasse“ nicht aus, um komplexe gesellschaftliche Verhältnisse angemessen zu analysieren und zu bewerten. Hierzu braucht es, wie vom Anti-Rassismus-Ausschuss gefordert, eine gesellschaftlich wie institutionell geteilte Definition von Rassismus. Diese muss gerade auch gegenwärtigen Argumentationen gerecht werden, die meist ohne den Verweis auf „Rassen“ respektive biologische Merkmale auskommen und stattdessen auf Differenzannahmen aufgrund von Merkmalen wie „Religion“ oder „Kultur“ basieren.
Diese Merkmale werden in der Diskussion jedoch häufig gleichsam als undurchlässig und quasi-natürlich konstruiert und schließlich als Legitimationen gesellschaftlicher Dominanz- und Ungleichheitsverhältnisse herangezogen. Eine solch „weite“ Rassismusdefinition, die seit einigen Jahren unter der Bezeichnung des „Neo- oder Kultur-Rassismus“ Eingang in die Forschung gefunden hat, sensibilisiert dafür, dass rassistische Argumentationsmuster heute versteckter auftreten und sich so Ausdruck und Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft verschaffen (vgl. Ausgaben 3/15, 7/14).
Zur Rassismus-Auffassung
des UN-Ausschusses gehört auch, dass sie Rassismus nicht als individuelle Eigenschaft verbucht, sondern als gesamtgesellschaftlichen Diskurs, der sich auch durch die staatlichen Institutionen zieht (vgl. Ausgabe 7/14). Die kritischen Fragen des UN-Ausschusses, denen sich die Bundesregierung stellen musste, zielten deshalb vor allem auf Aspekte eines institutionell verankerten Rassismus in Deutschland ab: Warum sind rassistische institutionelle Praktiken wie polizeiliche Personenkontrollen nach äußerlichen Merkmalen, sogenanntes „Racial Profiling“, in Deutschland noch immer präsent? Warum deckt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Diskriminierung durch öffentliche Behörden nur unzureichend ab? Wie kommt es, dass die Anti-Rassismus-Konvention in der deutschen Rechtspraxis so gut wie keine Rolle spielt (vgl. Ausgaben 9/13, 9/12)?
Auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie das Deutsche Institut für Menschenrechte merken an: Gesetzliche Änderungen, nach denen rassistische oder sonstige menschenverachtende Motive bei der Strafzumessung künftig stärker berücksichtigt werden sollen (vgl. Ausgabe 4/14), können nur Wirkung entfalten, wenn sie „von polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Dienstvorschriften und Richtlinien sowie durch gezielte Fortbildungen von Polizei und Justiz flankiert werden“. Dass dies noch nicht der Fall ist, darauf weist der Anti-Rassismus-Ausschuss der UN in seinem Abschlussbericht ausdrücklich hin. Damit gelingt ihm eine wichtige Perspektiverweiterung auf gegenwärtige Formen von Rassismus. Er sensibilisiert zugleich für dessen indirekte wie institutionelle Erscheinungsformen außerhalb des rechtsextremistischen Rands und fordert Staat und Gesellschaft auf, auch in Deutschland künftig deutlicher über Rassismus zu sprechen.
„Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“ Deutschland ist einer von 177 Staaten, die das Übereinkommen seit dessen Inkrafttreten 1969 unterzeichnet haben. Dieses verbietet staatliche Diskriminierung und verpflichtet die Vertragsstaaten zur Bekämpfung rassistischer Hassreden sowie der Diskriminierung von Einzelpersonen. In regelmäßigen Abständen müssen die Staaten einen Bericht zur Durchführung des Übereinkommens dem Anti-Rassismus-Ausschuss (CERD) der Vereinten Nationen vorlegen, der anschließend Empfehlungen an die Staaten ausspricht. Zivilgesellschaftliche Organisationen können eigene Informationen in das Prüfverfahren einbringen.
Im diesjährigen Verfahren reichten sieben Organisationen und Initiativen entsprechende Berichte ein. Der UN-Ausschuss ist darüber hinaus für Individualbeschwerdeverfahren zuständig, bei denen Einzelpersonen oder Gruppen Beschwerde aufgrund rassistischer Diskriminierung einlegen können, wenn im Vertragsstaat bereits alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Die Entscheidungen des Ausschusses sind völkerrechtlich verpflichtend, jedoch nicht rechtlich bindend und sehen dementsprechend keine Sanktionsmöglichkeiten vor.